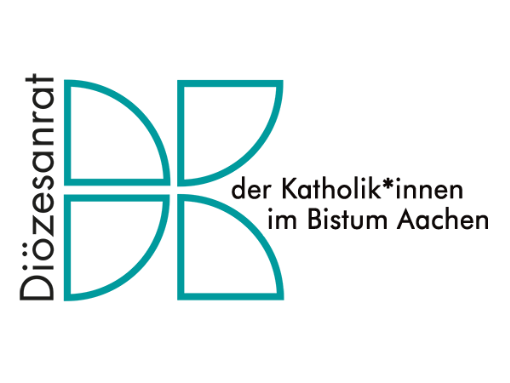Pumpspeicherkraftwerke im Tagebauloch: einmalige Chance oder unrealistisch?


Die Energiewende stößt zurzeit an spürbare Grenzen. Zwar wird immer mehr Strom aus regenerativen Energiequellen erzeugt. Aber es fehlt an Vorrichtungen, welche die Energie zwischenspeichern und bei Bedarf wieder ins Stromnetz speisen. So müssen immer wieder Windkrafträder und Photovoltaikanlagen abgeschaltet werden, um das Netz nicht zu überlasten. Und es müssen klimaschädlich betriebene Kraftwerke eingesetzt werden, um Versorgungslücken etwa in dunklen und windarmen Zeiten zu schließen.
Eine saubere Lösung für das Problem können Pumpspeicherkraftwerke sein. Sie speichern Energie, in dem sie Wasser in ein Oberbecken pumpen. Sie geben diese Energie wieder ab und wandeln sie in Strom um, wenn das Wasser Hunderte Meter in die Tiefe fließt und dabei Turbinen antreibt. Das lässt sich binnen kürzester Zeit einrichten, so dass diese Kraftwerke bedarfsgerecht überschüssige oder fehlende Energie im Netz puffern können. Seit 100 Jahren ist das Konzept bekannt und international eingesetzt.
Die Voraussetzung dafür ist eine gewisse Fallhöhe zwischen Ober- und Unterbecken. Deshalb findet man diese Werke in gebirgigen Gegenden. Der Frankfurter Physiker Prof. Dr. Horst Schmidt-Böcking wirbt allerdings seit einigen Jahren mit Nachdruck dafür, die großen Tagebaue im Rheinischen Revier genauso zu betrachten und dort im großen Stil Pumpspeicherwerke für das deutsche Stromnetz zu bauen. Eine einmalige Chance, denn Naturschutzauflagen stünden in einer so zerstörten Landschaft dem Projekt nicht im Wege, sagte er jetzt in Düren.
Der Diözesanrat der Katholik*innen im Bistum Aachen hatte zu einem konstruktiven Austausch über die Vision des Professors eingeladen. Diese unterstützte Horst Lambertz als Mitglied des Regionalrates voll umfänglich. Der stellvertretende Landrat im Kreis Rhein-Erft (Bündnis 90/Die Grünen) bedauerte, dass in Nachfolge zu den Studien von Horst Schmidt-Böcking keine weiterführenden Machbarkeitsuntersuchungen beauftragt wurden. Das Vorhaben der Pumpspeicherkraftwerke sei von vorneherein politisch geblockt worden.

Eine entschieden ablehnende Haltung zeigte in Düren auch der Leiter der Tagebauplanung von RWE. Als Ingenieur findet Hendrik Stemann das Konzept zwar spannend. Aber er führte ein ganzes Bündel an Argumenten an, warum RWE die Errichtung von Pumpspeicherkraftwerken in den Restlöchern der Rheinischen Braunkohletagebaue ablehnt. Die wichtigsten aus seiner Sicht: die geologischen Rahmenbedingungen vor Ort, die planerischen Vorläufe unter Bergrecht und eine mögliche Verschlechterung der späteren Freizeitfolgenutzung.
Im folgenden, respektvoll ausgetauschten Hin und Her der Argumente in Düren hätten wohl die Machbarkeitsstudien geholfen, die aber halt nicht vorliegen. So blieben eher mahnende Appelle das Gebot der Stunde. Die Klimakrise dulde keine weitere Verschleppung der Energiewende, sagte Misereor-Referentin Madeleine Wörner. Sie warnte davor, auf chemische Technologien wie Lithium-Ionen-Batterien zu setzen. Die Rohstoffe würden unter hohen ökologischen und sozialen Kosten gewonnen und internationale Abhängigkeiten schaffen.
Die Referentin plädierte dafür, zivilgesellschaftliche Dialoge über die Lösung der Energiefragen zu fördern. Das war ganz im Sinne des Diözesanrats, der Mitglied im Netzwerk "Revier WIRd Region" ist. In diesem Sinne würdigte auch Moderator Linus Platzer das Geschehen auf dem Podium. Das rege Interesse und der engagierte Austausch bei der Veranstaltung zeigten: Es gibt Bedarf, gemeinsam mit den beteiligten Akteuren über die Zukunftsplanungen zu sprechen. Hier ist Luft nach oben, wie Madeleine Wörner betonte. Der Diözesanrat bleibt dran.